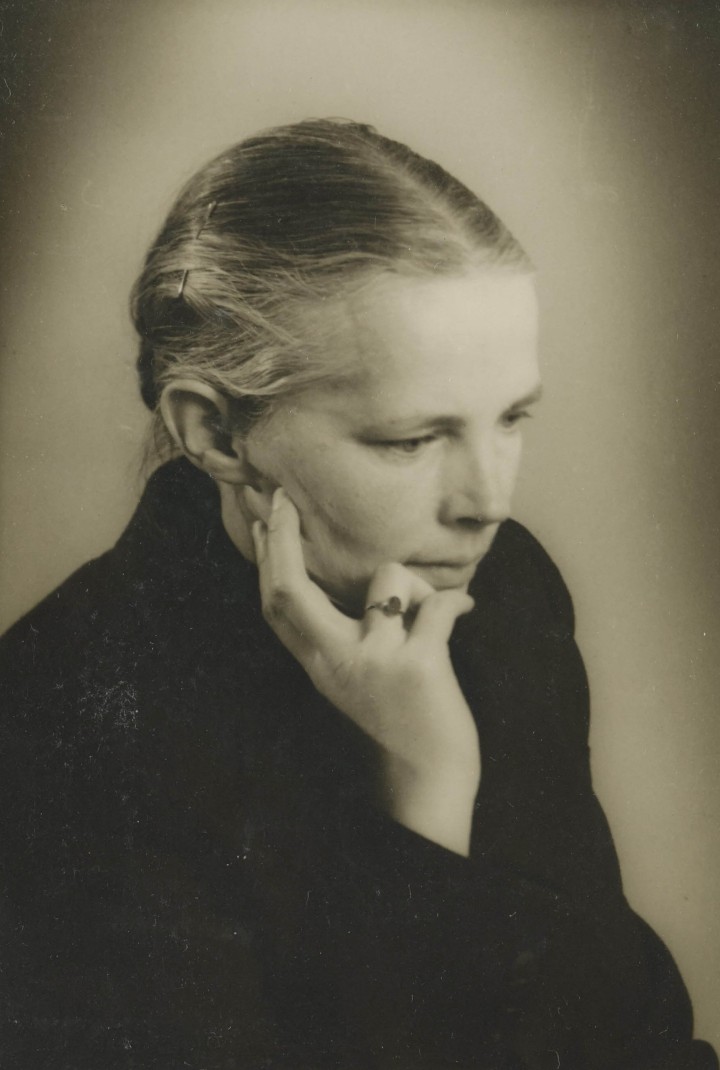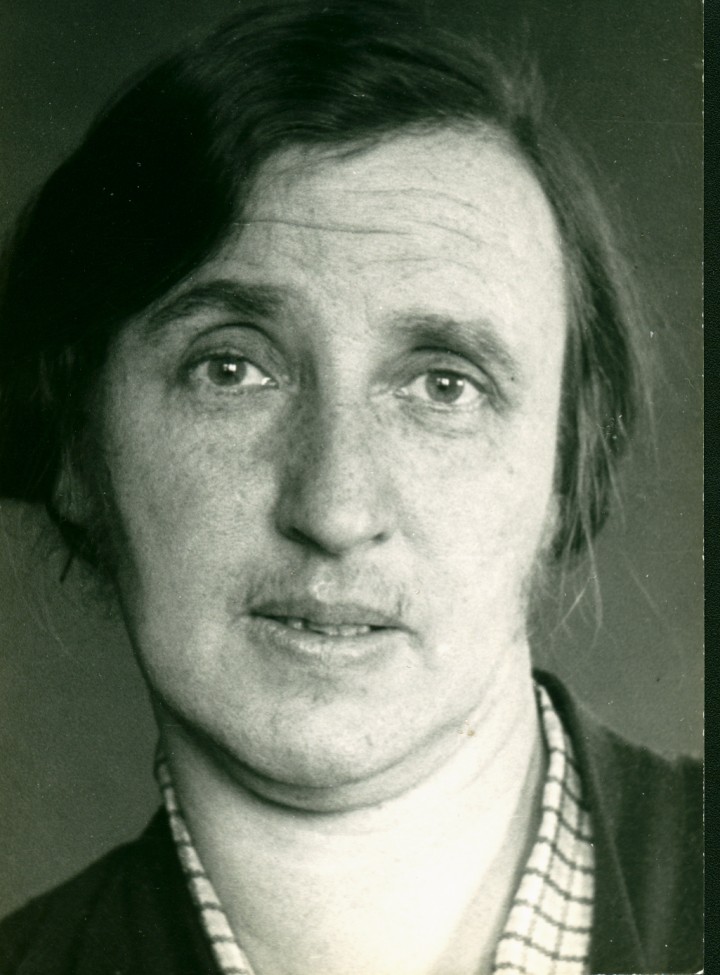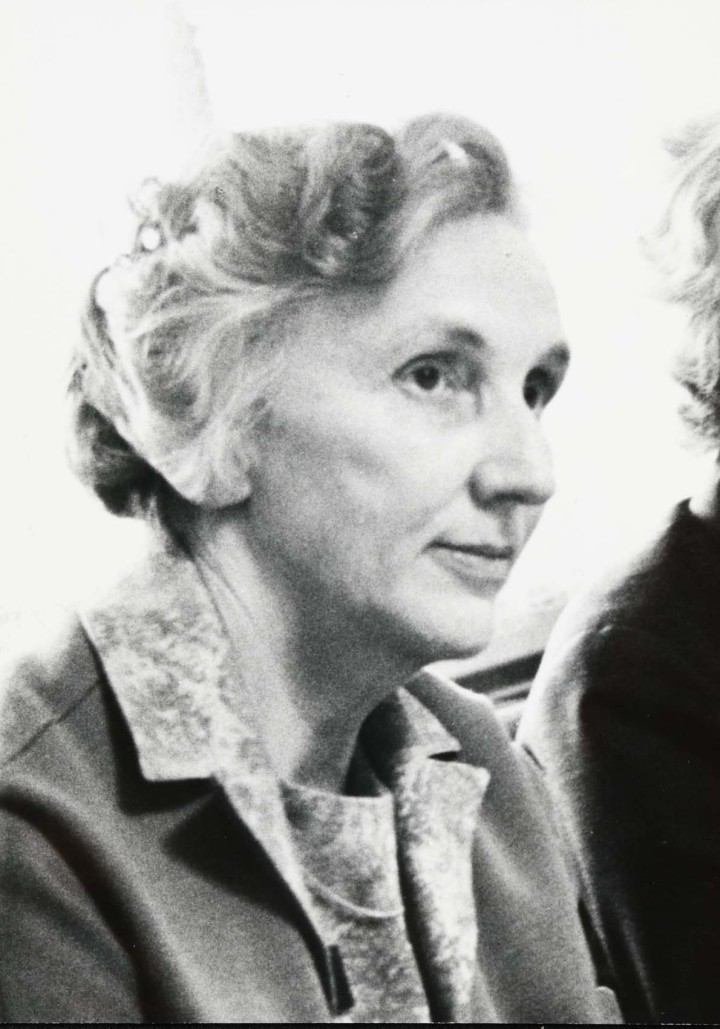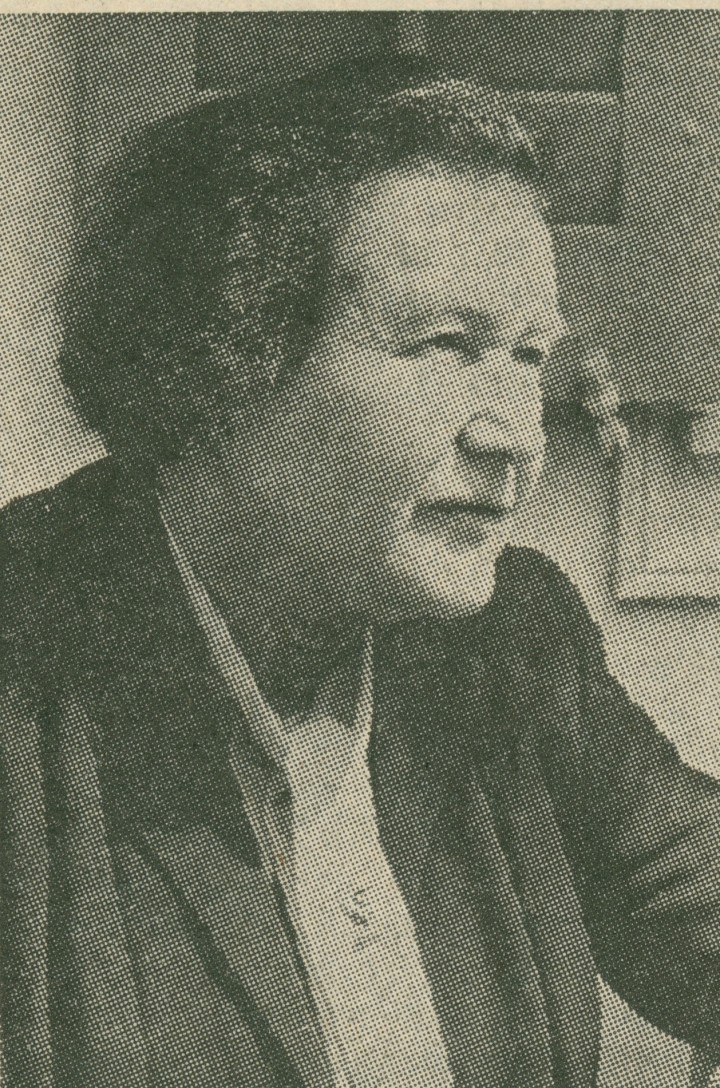Patenfrauen
Für CHF 50.— pro Jahr können Sie die Patenschaft für ein beliebiges Dossier aus unserer Sammlung biografischer Notizen übernehmen. Für einen Archivbestand einer Frau variieren die Kosten für eine Patenschaft zwischen CHF 100.— und 2’000.— je nach Umfang der Archivmaterialien.
-
Gertrud Heinzelmann (1914-1999)
Ausbildung/Berufstätigkeit: Ausbildung am Mädchengymnasium der Stadt Zürich. Studium der Rechtwissenschaften an der Universität Zürich. Dissertation "Das grundsätzliche Verhältnis von Kirche und Staat in den Konkordaten" 1942 bei Zaccaria Giacometti in Allgemeinem Staatsrecht: 1938-1941. Auditoriat am Bezirksgericht Zürich: 1942-1943. Schriftstellerische Tätigkeit. Rechtsanwältin bei der Schutz AG / Büro Dr. Eigenmann, Rechtsschutzversicherung: 1949-1961. Leiterin Büro gegen Amts- und Verbandswillkür Migros-Genossenschaftsbund: 1964-1976, Sekretärin: Hedwig König Würgler. 1961, 1971/1972 und 1975 Aufenthalte in Brasilien. Studium der Kunstgeschichte, Archäologie und Kirchengeschichte an der Universität Zürich: 1976-1984.
Gesellschaftliches Engagement: Frauenstimmrechtsverein Zürich: Mitglied: ab 1954, Vizepräsidentin: 1956-1962, Präsidentin: 1962-1966, Ehrenmitglied. Schweizerischer Verband für Frauenstimmrecht (später: Schweizerischer Verband für Frauenrechte): Zentralvorstandsmitglied: 1956-1976, Präsidentin: 1959-1960, Mitglied Juristische Kommission, Präsidentin Juristische Kommission: ab 1972, Ehrenmitglied. Verfasserin von Texten und wissenschaftlichen Studien zur Diskriminierung der Frauen in der katholischen Kirche, zum Frauenstimm- und Wahlrecht. Eingabe an das 2. Vatikanische Konzil vom 23. Mai 1962. Forderung der Gleichstellung der Geschlechter in der katholischen Kirche und Zulassung der Frauen zur Ordination. Gründung Interfeminas-Verlag, der erste deutschsprachige Verlag für Frauenpublikationen: 1962. Einzelmitglied der St. Joan's International Alliance: ab 1963. Mitarbeit in der interdiözesanen Sachkommission 9, "Beziehungen zwischen Kirchen und politischen Gemeinschaften" und Einberufung in die Synode 72 im Bistum Chur: 1969-1974. Frauenkommission Migros-Genossenschafts-Bund: 1976. Mitglied der Arbeitsgruppe Strafvollzug der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen: 1976-1978. Mitglied Initiativkomitee der Volksinitiative "Gleiche Recht für Mann und Frau".
Preisverleihungen: Auszeichnung Binet-Fendt-Preis (1981), Ida-Somazzi-Preis (1992) und der Gesellschaft zu Fraumünster (2001) als Anerkennung für ihr Engagement für die Rechte der Frau.
CHF 2‘000.— (12.8 Lfm)
Foto: AGoF FS-485
-
Agnes Debrit-Vogel (1892-1974)
Agnes Debrit-Vogel war die Tochter von Catherine Vogel, geborene Michel, und Fritz Vogel. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Lehrerinnenseminars Bern studierte sie Philologie an der Universität Bern. Nach dem Doktorat bildete sie sich als Journalistin aus und arbeitete als freie Mitarbeiterin für verschiedene Zeitungen sowie für die Frauenzeitung BERNA und interimistisch für das „Mouvement Féministe“ als Redaktorin. Neben ihrem Beruf engagierte sich Agnes Debrit-Vogel in der Schweizerischen Frauenbewegung; sie gilt auch als deren Chronistin. Agnes Debrit-Vogel war Mitarbeiterin der SAFFA 1928; Mitinitiatorin des Zivilen Frauenhilfsdienst und der Auslandschweizerhilfe während des 2. Weltkriegs; Mitglied des Schweizerischen Frauenstimmrechtsvereins; an der SAFFA 1958 präsidierte sie die Bernische Kantonalkommission und zwischen 1959-1966 war sie Präsidentin des Bernischen Frauenbundes. Im Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF) war sie ab 1938 viele Jahre im Vorstand tätig und Mitglied der Presse- und Erziehungskommission. 1972 schenkte sie dem BSF eine grosse Sammlung biografischer Notizen von Schweizer Frauen. Diese Sammlung befindet sich heute im Gosteli-Archiv in Worblaufen.
1921 heiratete Agnes Debrit-Vogel den Journalisten Jean Debrit. 1922 kam ihr gemeinsamer Sohn Felix zur Welt. Die Familie wohnte im Engequartier in Bern.
CHF 1‘000.— (4.5 Lfm)
Foto: AGoF 530:3:51-10
-
Elisabeth Anna Feller (1910-1973)
Nach dem Tod ihres Vaters Adolf Feller Abruch ihres Geografiestudiums und Eintritt in die Geschäftsleitung der Elektronikfirma Feller. Bis zu ihrem plötzlichen Tod Leitung der Firma zusammen mit ihrer Mutter Emma Feller und erfahrenen Mitarbeitern.
1947 Mitgründerin und zugleich erste Präsidentin des Schweizerischen Verbands der Berufs- und Geschäftsfrauen. 1959 - 1962 Präsidentin der International Federation of Business and Professional Women. Kunstmäzenin. Mitinitiatorin des Pestalozzi Kinderdorfes in Trogen und beim Albert Schweitzer Spital in Lambarene. Zudem reiste Elisabeth Feller beruflich und auch privat gerne. Sie war gerne in den Schweizeralpen und machte als junge Erwachsene regelmässig Skitouren im Fextal.
CHF 1‘000.— (5.7 Lfm)
Foto: AGoF 671:39:60-01
-
Dorothee Hoch (1917-1996)
Theologin und Pfarrerin, kirchliche Supervisorin. Mitarbeit Comité Intermouvement Auprès des Evacués. Spitalseelsorgerin in Riehen, Spitalpfarrerin am Frauenspital Basel.
CHF 1‘000.— (3.1 Lfm)
Foto: AGoF FS-1091
-
Erna Hoch (1919-2003)
Psychiaterin. Ab 1956 Arbeit in verschiedenen Kliniken in Indien. Zwischen 1969 - 1980 ärztliche Direktorin und gleichzeitig Professorin der Psychiatrie im einzigen Psychiatriespital in der Provinz Kashmir. 1988 Rückkehr in die Schweiz. Verfasserin des Buches „Sources sans Ressources“.
CHF 1‘000.— (7.3 Lfm)
Foto: AGoF 657:8:02-01
-
Verena Pfenninger-Stadler (1904-1999)
Geboren am 29.03.1904 in Zürich, gestorben am 27.01.1999 in Fällanden. Vollständiger Geburtsname: Martha Verena Stadler. Tochter von Marie (geb. Marti) und August Stadler (1850-1910), Professor für Philosophie an der ETH Zürich. Eine Schwester, Johanna Maria Landolt-Stadler (geb. 1903), verheiratet mit dem Politiker Emil Landolt (1895-1995). 1930 Heirat mit dem Theologen Walter Pfenninger (1904-1962). Zusammen hatten sie zwei Töchter, Ursula und Domenica (Spitzname Mengi).
Ausbildung: Besuch der Freien Schule Zürich 1 während der Primarschule und während vier Sekundarschuljahren, anschliessend vier Jahre Gymnasialabteilung der städtischen Töchterschule der Stadt Zürich, von Frühjahr 1920 bis Frühjahr 1924. Anschliessend ein halbes Jahr in einer Haushaltsschule am Thunersee. Ab Herbst 1924 Theologiestudium in Zürich, ab Frühjahr 1926 für zwei Semester in Marburg a.d. Lahm, später auch noch in Münster, wo sie bei Karl Barth Vorlesungen besuchte. Abschluss des Studiums in Zürich 1929.
Lernvikarin bei Herrn Pfarrer Boller in Zürich Aussersihl. 1930 u.a. in Köln als Delegierte der christlichen Studentenvereinigung an einer Konferenz, die den Austausch amerikanischer und europäischer Gedanken bezweckte. Verlobung mit Walter Pfenninger im Frühjahr 1930. 1931 bis 1939 in Brig, 1939-1950 in Romanshorn und ab 1950 in Zürich tätig. 1963 erhielt sie im Zürcher Grossmünster zusammen mit einer Gruppe von Theologinnen die Ordination zur Pfarrerin.
CHF 1‘000.— (4.4 Lfm)
Foto: AGoF 619-19
-
Gerda Stocker-Meyer (1912-1997)
Gerda Stocker-Meyer (26.08.1912-19.11.1997), verheiratet ab 1946 mit dem Maler und Mosaikkünstler Arnold Stocker, war eine der ersten hauptberuflichen Journalistinnen der Schweiz. Neben ihrem Beruf engagierte sie sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie für die Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonal-bernischer und eidgenössischer Ebene. Stocker-Meyer leitete Pressedienste, verfasste Flugschriften und Broschüren wie auch Presse- und Dokumentationsmappen für die eidgenössische Abstimmung von 1971. Gerda Stocker Meyer arbeitete zudem in den Aufsichtsgremien der SRG, in der Studiengruppe für Konsumentinnenfragen, der Arbeitsgemeinschaft "Frau und Demokratie" und im Pressedienst der Schweizerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe. Zudem thematisierte sie in ihrer publizistischen Tätigkeit Natur-, Tier- und Umweltschutzfragen. 1973 erhielt Gerda Stocker Meyer den Ida Somazzi-Preis.
CHF 1‘000.— (3.6 Lfm)
Foto: AGoF FS-726
-
Else Züblin-Spiller (1881-1948)
Erste Berufserfahrungen als Papeterieverkäuferin, Kellnerin und Journalistin. Im ersten Weltkrieg Gründung des Schweizer Verbands Soldatenwohl und Eröffnung von gegen 1‘000 Soldatenstuben als alkoholfreie, kostengünstige Alternative zu den Wirtshäusern. Ab 1920 unter dem neuen Namen Schweizer Verband Volksdienst (SV-Service) Erweiterung des Aufgabenbereichs und Übernahme des Betriebs von Kantinen und Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeitnehmer.
CHF 1‘000.— (3.5 Lfm)
Foto: AGoF 180:538:605-37
-
Eva Bernoulli (1903-1995)
Eva Bernoulli, geboren am 04.03.1903 in Berlin, aufgewachsen in Arlesheim und verstorben am 12.06.1995 in Basel, war die erste Logopädin der Schweiz und leistete Pionierarbeit in der Sprach- und Stimmtherapie.
Ab 1923 besuchte Eva Bernoulli in München die Schule für Rhythmische Gymnastik. Von 1925 bis 1928 absolvierte sie ihre Ausbildung in Sprechtechnik und Dramaturgie am Basler Konservatorium und übernahm danach die Leitung des Sprechchors im Stadttheater Basel. 1929 ging sie als Au-Pair nach Italien. Danach arbeitete sie in Basel als Sprechtherapeutin unter anderem für Stotterer und Taubstumme. 1934 ging sie nach München und Paris und liess sich in der Sprecherziehung weiterbilden. Von 1936 bis 1940 leitete Eva Bernoulli die Kammerspiele Bernoulli in Basel. Während des Zweiten Weltkrieges war sie beim Frauenhilfsdienst (FHD) tätig.
Seit 1939 besitzt Eva Bernoulli die offizielle Bewilligung, als Hilfskraft von Fachärzten Sprachheilunterricht zu erteilen und therapiert Patienten nach einer Kropf-, einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten- oder einer Kehlkopfoperation. 1948 erwarb sie das Diplom für Logopädie der SAS in Zürich und arbeitete danach selbständig als erste Logopädin der Schweiz. Von 1965 bis 1973 arbeitete sie in der Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen (GSR) und von 1942 bis 1963 arbeitete sie auch als Religionslehrerin. Daneben trat sie oft bei Lesungen auf, wirkte bei Radiohörspielen mit, führte einen Kurs für Baseldeutsch und veröffentlichte drei Bücher.
Sie war Mitglied beim Lyceum-Club Basel, dem Zonta-Club Basel und der Akademikerinnen-Vereinigung Basel. Für ihre Arbeit erhielt Eva Bernoulli 1986 den Ehrendoktortitel Dr. med. h. c. der Universität Basel und wurde zum Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Phoniatrie und der Kehlkopflosenvereinigung ernannt.
CHF 500.—(2 Lfm)
Foto: AGoF 549-175
-
Ruth Elisabeth Bietenhard-Lehmann (1920-2015)
Ruth Elisabeth Bietenhard-Lehmann (11.01.1920-19.02.2015), absolvierte die Seminarschule Muristalden, die Neue Mädchenschule und das Freie Gymnasium, welches sie 1938 mit der A-Matur abschloss. Nach einem Au-pair Aufenthalt in Paris begann Ruth Bietenhard 1939 das Studium der Romanistik in Genf und Bern. Sie erlangte 1945 das Höhere Lehramt und promovierte im folgenden Jahr mit der Arbeit "Le sémantisme des mots expressifs en Suisse romande". Im selben Jahr heiratete sie den Pfarrer Hans Bietenhard. Neben den Aufgaben als Mutter von 6 Kindern und Pfarrfrau übernahm sie Stellvertretungen an Gymnasien und Berufsschulen. Von 1977 bis 1980 arbeitete sie in voller Anstellung am kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerseminar Thun. Sie engagierte sich in der Kirchgemeinde Steffisburg als Kirchenrats- und Kirchgemeindepräsidentin und arbeitete in der Redaktion des "Saemann". In den 1970er Jahren wandte sich Ruth Bietenhard wieder stärker wissenschaftlichen Arbeiten zu. Sie bearbeitete das Wortmaterial zur berndeutschen Mundart von Otto von Greyerz, welches 1976 als Berndeutsches Wörterbuch herausgegeben wurde. Ihre Faszination für die Mundartforschung fand eine Fortsetzung in der Herausgabe und Mitautorenschaft am Band "Oberländer Mundarten", welcher 1991 publiziert wurde. Seit 1976 schrieb Ruth Bietenhard für die Berndeutsch-Kolumne Stübli im "Bund". In Zusammenarbeit mit ihrem Mann entstand zwischen 1980 und 1983 zudem eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Berndeutsche. Dem Neuen Testament folgte eine Auswahl an Texten aus dem Alten Testament, welche Ruth und Hans Bietenhard gemeinsam mit ihrem Sohn Benedikt ins Berndeutsche übertrugen. 1993 erfolgte auch eine Gesamtausgabe der Psalmen. Ruth Bietenhard erhielt zahlreiche Ehrungen, unter anderem die Burger-Medaille der Stadt Bern und 1993 das Ehrendoktorat der theologischen Fakultät der Universität Bern.
CHF 500.— (2.5 Lfm)
Foto: AGoF 638:19:04-04
-
Marie Boehlen (1911-1999)
Primarlehrerin, promovierte Juristin, Fürsprecherin. Sekretariatsstellen am Obergericht des Kantons Bern, in einem Anwaltsbüro, bei der Wehrmanns-ausgleichskasse des Kantons Bern, bei der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern und auf dem Regierungsstatthalteramt Bern. Jugendanwältin der Stadt Bern. Präsidentin Frauenstimmrechtsverein Bern, bernisches Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde, für Berufs-interessenkommission Schweiz. Verband der Akademikerinnen. Mitglied Sozialdemokratische Partei und Verband Personal öffentlicher Dienste.
CHF 500.— (2.3 Lfm)
Foto: AGoF 566-89, Photopress AG
-
Lily Brugger-Blanc (geb. 1925)
Lily Brugger-Blanc (21.05.1925 in Biel/Bienne - 29.01.2020 in Bern) war eine der ersten Agronominnen ETH der Schweiz. Sie besuchte in Bern die "Bubenschule", d.h. das Progymnasium ohne Handarbeits- und Hauswirtschaftsunterricht und studierte nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit von 1944 bis 1949 an der ETH Zürich Agronomie. Während und nach dem Studium arbeitete Lily Brugger-Blanc in Holland und Frankreich und 1949 als Dienstmädchen in New York und auf einer Farm in Ohio. Danach war sie als Assistentin und Sekretärin von Prof. Walter Pauli im statistischen Bureau des Kantons Bern tätig und unterrichtete daneben die landwirtschaftlichen Fächer an der Haushaltungsschule Worb. Ab den späten 1960er-Jahren engagierte sie sich zunehmend ehrenamtlich, beispielsweise als Sekretärin und Mitbegründerin des Zusammenschlusses von Eltern geistig Behinderter in der Region Bern. Lily Brugger-Blanc präsidierte von 1947 bis 1978 die Vereinigung Bernischer Akademikerinnen. Von 1968 bis 1992 war sie im Vorstand und dem Geschäftsausschuss der Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA. Lily Brugger-Blanc vertrat die Frauenzentrale Bern, in deren Vorstand sie 12 Jahre mitwirkte, in der Gemüsebörse. Sie war Mitglied im Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF) und vertrat diesen ab 1980 in der Genossenschaft für Schlachtvieh- und Fleischversorgung (GSF). Zudem engagierte sie sich in der reformierten Kirche und war Präsidentin des Grossen Kirchenrates Bern. Lily Brugger-Blanc war Gründungsmitglied und Präsidentin der Frauengruppe der Bürgerpartei der Stadt Bern. Von 1973 bis 1982 war sie Stadträtin und von 1982 bis 1986 Grossrätin des Kantons Bern.
CHF 500.— (2.3 Lfm)
Foto: AGoF FS-434
-
Emanuele Meyer-Schweizer (1866-1949)
Emanuele Meyer-Schweizer (03.12.1866 in Eppendorf (Deutschland) - 19.01.1949 in Arosa); Schriftstellerin, Autorin sozialethischer und pädagogischer Literatur. In Vorträgen und Publikationen Engagement für die Gleichberechtigung der Frauen.
Ausbildung/Berufstätigkeit
Ärztin (Medizinstudium an der Universität Innsbruck), Theologin (besuchte Vorlesungen an der Theologischen Fakultät), Schriftstellerin, Missionshelferin in Kalifornien, Leiterin der Kriegskinderhorte in Köln während des 1. Weltkrieges, Vortragsreisen in der Schweiz und im Ausland.Gesellschaftliches Engagement
Publikation medizinischer, kirchen-, sozial- und gesellschaftskritischer Schriften. Autorin von Fachbüchern und Aufklärungsliteratur. Engagements in der Wohlfahrt und Fürsorgearbeit. Ihr Einsatz für die Besserstellung der Frau – auch in der katholischen Kirche – führte zu einem Redeverbot, verhängt von Bischof Georgius Schmid von Grünegg.Familie/Kinder
Die Ehe mit ihrem Mann wurde als ungültig erklärt, da er die Priesterweihe empfangen hatte. Emanuele Meyer-Schweizer verlangte die Scheidung. Die drei Kinder wuchsen bei ihrer Mutter, vor allem aber in Internaten und Klöster auf. Früher Tod ihres Sohnes Emanuel (1918), Tod von Pia 1943, Josephine in Paris verschwunden (1918).Ärztin und Missionshelferin in den USA und in Süddeutschland und Wien. Schriftstellerin, Autorin sozialethischer und pädagogischer Literatur. In Vorträgen und Publikationen Engagement für die Gleichberechtigung der Frauen.CHF 500.— (2.6 Lfm)
Foto: AGoF 554-316
-
Gertrud Lutz-Fankhauser (1911-1995)
Gattin des Schweizer Konsuls in Budapest. Mitarbeiterin Internationales Rotes Kreuz in Palästina, Deutschland und Italien. Mitarbeit für die Schweizer Spende in Jugoslawien, Finnland und Polen. UNICEF-Delegierte in Brasilien und der Türkei. Vizedirektorin UNICEF-Regionalbüro Europa.
Ehrungen: Medaille der Gerechten durch israelische Botschaft in der Schweiz, Ehrenbürgerin mehrerer brasilianischer und türkischer Städte.
CHF 500.— (2.5 Lfm)
Foto: AGoF 550:3:16-02
-
Helene Thalmann-Antenen (1906-1976)
Promovierte Juristin, Anwältin. Präsidentin Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik, Schweizerischer Verband der Akademikerinnen und Kommission für die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Frau im internationalen Verband der Akademikerinnen. Initiantin und erste Präsidentin der Kommission für die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Frau im Schweizerischen Verband der Akademikerinnen. Rechtsberaterin des Bernischen Frauenbundes. Mitglied Schweizerische Arbeitsgemeinschaft "Frau und Demokratie", Expertenkommission für das allgemeine Arbeitsgesetz und die Revision des Dienstvertrages und Schweizerischer Verband der Berufs- und Geschäftsfrauen. Auszeichnungen: Ida-Somazzi-Preis und Adelaide-Ristori-Preis (Centro Culturale Italiano). Engagement im Arbeitsrecht, in der Sozialpolitik und für die Gleichberechtigung der Frauen sowie die Einführung des eidgenössischen Frauenstimmrechts.
CHF 500.— (2.4 Lfm)
Foto: AGoF FS Helene Thalmann-Antenen
-
Emmi Bloch (1887-1978)
Sozialarbeiterin, Berufsberaterin. Leiterin Kurse für soziale Kinderfürsorge, 1933-1944 Redaktorin Schweizer Frauenblatt. Sekretärin Zürcher Frauenzentrale, Mitbegründerin Zürcher Frauenhilfe, Zürcher Frauenzentrale, Berufsberatung für Frauen und Berufsverein für Sozialarbeiter Zürich, Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Frau und Demokratie.
CHF 200.— (1.8 Lfm)
Foto: AGoF FS-1016
-
Margrit Bohren-Hoerni (1917-1995)
Promovierte Juristin, Rechtsanwältin. Sekretärin der Kantonsverwaltung Zürich. Mitglied Geschäftsleitung, geschäftsführende Direktorin und Präsidentin Schweizer Verband Volksdienst. Präsidentin Arbeitsgemeinschaft der Vereinigungen alkoholfreier Betriebe. Vorstandsmitglied Europäische Vereinigung für soziale Gemeinschaftsverpflegung. Mitglied eidg. Kommission für Volksernährung, Lebensmittelgesetzgebung und - kontrolle, Aufsichtsrat Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt. Mitglied im Verwaltungsrat Grands Magasins Jelmoli, Schweizerische Volksbank, Verkehrsverein Stadt Zürich. Mitglied Direktionskomitee Pro Senectute. Kantonsrätin FDP Zürich, Präsidentin: Vereinigung freisinnig-demokratischer Frauen des Kantons Zürich. Mitglied Kommission für Sozialpolitik der FDP Kanton Zürich, Fachkommission "Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen" des Bundes Schweizerischer Frauenvereine, Abteilung "Lob der Arbeit" Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) 1958. Auszeichnungen: Premio Adelaide Ristori in Rom, Ehrendoktorat der medizinischen Fakultät Universität Bern.
CHF 200.— (1.7 Lfm)
Foto: AGoF 180-FS-1303
-
Kunigund Feldges-Oeri (1911-1997)
Theologiestudium. Arbeit als Lehrerin. Einsatz für die Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung der Landfrauen im Kanton Bern und für die Anerkennung der Menschenrechte.
Erste Präsidentin der 1934 gegründeten kantonalbernischen Pfarr-frauenvereinigung. Ab den späten 1960er Jahren Vorstandsmitglied und ab 1972 Präsidentin des Schweizerischen Evangelischen Frauenbundes. Vertreterin des Schweizerischen Evangelischen Frauenbundes in der Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Frauenorganisationen für das Frauenstimmrecht.
Engagement für die Förderung der ökumenischen Zusammenarbeit der Schweizer Kirchen, Initiantin und Präsidentin der Frauenkommission der Europa-Union Schweiz, Mitarbeit in der Europäischen Frauenunion, Mitbegründerin der Schweizerischen Landessektion der europäischen Frauenunion; Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen des Europarats; Mitglied der Gesellschaft Schweiz/China.
CHF 200.— (2 Lfm)
Foto: AGoF FS-831
-
Marguerite Nobs (1928-1974)
Mitarbeiterin Internationales Komitee des Roten Kreuzes in Berlin. Sekretärin Frauenweltbund. Wateler-Friedenspreis.
CHF 200.— (1.5 Lfm)
Foto: AGoF FS-836
-
Helene Stucki (1889-1988)
Primarlehrerin, Sekundarlehrerin und Seminarlehrerin in Bern. Mitarbeit Frauenschule Stadt Bern. Gruppenleiterin Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) 1958. Vorstandsmitglied Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF). Präsidentin Kinderhilfe Rotes Kreuz, Sektion Bern. Ehrenmitgliedschaft Bund Schweizerischer Frauenvereine, Frauenzentrale Bern und Frauenstimmrechtsverein Bern. Ehrendoktorat Universität Bern. Publikationen zu erziehungswissenschaftlichen Fragen und Problemen der Lehrerinnenschaft. Engagement für Frauenstimmrecht, Lehrerinnenanliegen und Mädchenbildung.
CHF 100.— (0.1 Lfm)
Foto: AGoF FS-867
-
Hildegard Bürgin-Kreis (1904-1989)
Rechtsanwältin und Notarin in Basel, promovierte Juristin. Präsidentin Akademikerinnen-Vereinigung Basel. Vorstandsmitglied Frauenzentrale, Vereinigung für Frauenstimmrecht. Beraterin für den Schweizerischen Katholischen Frauenbund.
CHF 100.— (0.7 Lfm)
Foto: AGoF BN 985
-
Eugénie Dutoit (1857-1933)
Studium an den Universitäten Bern und an der Sorbonne in Paris. Als eine von wenigen Frauen dieser Zeit, erlangte sie 1898 die Doktorwürde in Philosophie. Um die Jahrhundertwende Gründung eines Lese- und Vortragszirkels in der Stadt Bern. Ab Mitte der 1920er Jahre Führung der Freundinnen junger Mädchen, Übernahme der organisatorischen Leitung für die Abteilung Unterrichtswesen der SAFFA 1928, Engagement bei den Vorarbeiten für das eidgenössische Alkoholgesetz.
CHF 100.— (0.3 Lfm)
Foto: Gosteli Bro M 69
-
Maria Felchlin (1899 - 1987)
Ärztin In Olten. Sanitätsoberleutnant bei den Luftschutztruppen. Präsidentin und Vorstandsmitglied Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Frau und Demokratie. Begründerin Club der Oltener Berufs- und Geschäftsfrauen. Redaktorin der Oltner Neujahrsblätter; Ehrenmitglied im Vortragsverein Akademia Olten, in der solothurnischen Vereinigung der freisinnigen Frauengruppen und im Stimmrechtsverband Olten. Publizistische Tätigkeit.
CHF 100.— (0.1 Lfm)
Foto: AGoF FS-1089
-
Emilie Gourd (1879-1946)
Historikerin. Mädchenschullehrerin in Genf, Sekretärin des Bundes Schweizerischer Frauenvereine (BSF), Gründerin der Zeitschrift "Mouvement Féminist" (später "Femmes Suisses"), Redaktorin "Jahrbuch für Frauenarbeit". Leiterin Frauenstimmrechtsverein, Präsidentin Schweizerischer Verband für Frauenstimmrecht. Vorstandsmitglied Weltbund für Frauenstimmrecht und staatsbürgerliche Frauenarbeit.
CHF 100.— (0.5 Lfm)
Foto: AGoF 553-64
-
Gertrud Haldimann-Weiss (1907-2001)
Gertrud Haldimann-Weiss (22.01.1907 - 25.12.2001) war eine der bestbekannten und vehementesten Gegnerinnen des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Sie engagierte sich in der Öffentlichkeit sowohl bei den eidgenössischen Abstimmungen 1959 und 1971 als auch bei verschiedenen kantonalen Urnengängen gegen die Einführung des Frauenstimmrechts. Gertrud Haldimann-Weiss war Vorsitzende des «Schweizerischen Frauenkomitees gegen das Frauenstimmrecht» von der zweiten Sitzung am 10. September 1958 bis zu dessen Überführung in den «Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht» am 22. Mai 1959. In diesem Verein war sie bis zur Versammlung vom 23. November 1967 Präsidentin, dann wurde sie zur Ehrenpräsidentin des Schweizerischen Bundes ernannt, was sie bis 1971 in aktiver Rolle blieb. Jda Monn-Krieger aus St. Niklausen (Luzern), die Aktuarin, übernahm das Präsidium.
1959 gründete und präsidierte Frau Haldimann-Weiss auch den «Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht – Kanton Bern». In dieser Kantonalsektion blieb sie nach vorhandenen Angaben Präsidentin bis zur eidgenössischen Abstimmung 1971. Gertrud Haldimann-Weiss trug sich am 10. September 1958 mit folgenden Eingaben in die Präsenzliste des «Schweizerischen Frauenkomitee gegen das Frauenstimmrecht» ein: «Apothekerin, protestantisch, freisinnig» (Dossier 4/4), obwohl eine Parteimitgliedschaft auszuschliessen ist. Der Grossteil des Privatarchivs besteht aus Akten, welche in Zusammenhang mit dieser politischen Arbeit entstanden sind.
Gertrud Weiss wurde am 22. Januar 1907 als jüngstes von sechs Kindern des Rudolf Weiss, Spenglermeister, und der Marta, geborene Hari, in Bern geboren. Mit 13 respektive 14 Jahren verlor sie ihren Vater und den geschätzten ältesten Bruder. Nach dem Gymnasium studierte sie Pharmazie an der Universität Bern mit Abschluss im Mai 1931. Im Mai 1933 heiratete sie den Augenarzt Dr. Carl Haldimann. Die Familie lebte am Kollerweg 18 mit den Kindern Rudolf, Peter, Elisabeth, Franz, Therese und Beat. Frau Haldimann-Weiss leistete administrative Mitarbeit in der Praxis ihres Gatten an der Kramgasse 16 in Bern. Herr Carl Haldimann verstarb 1983, nachdem bereits frühere gesundheitliche Probleme grosse Fürsorge der Gattin bewirkten. 1987 erlag die jüngere Tochter Therese einem Krebsleiden. 1998 zog Frau Haldimann-Weiss vom Gryphenhübeliweg 21 in die Senioren Residenz Grüneck. Frau Haldimann-Weiss verstarb dort kurz nach einem Schlaganfall am 25. Dezember 2001.
CHF 200.— (1.2 Lfm)
Foto: AGoF BN Haldimann-Weiss Gertrud, sie+er 14.01.1971
-
Mina Hofstetter (1883-1967)
Mina Hofstetter-Lehner arbeitete nach der Schule als Dienstmädchen in Genf und Berlin. Auf Drängen von Mina erwarb ihr Mann Ernst 1915 den Hof "Stuhlen" in Ebmatingen (ZH). Nach einer schweren Krankheit wurde Mina Hofstetter Anfang der 1920er Jahre Vegetarierin. In den 1920er Jahren übernahm sie die Landwirtschaft, während ihr Mann sich wieder ganz dem Schreinergewerbe zuwandte. Ab 1927 führte Mina Hofstetter den Betrieb viehlos, machte Versuche über Reihensaaten und führte in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bauernsekretariat Buchhaltung auf ihrem Betrieb. Seit Anfang der 1920er Jahre war sie in der Freiwirtschaftsbewegung aktiv und hatte auch Kontakte mit anderen Pionieren des biologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum. Ab 1924 publizierte Hofstetter in der Zeitschrift Tao, später auch in anderen, der Lebensreformbewegung nahestehenden Publikationen. 1928 veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Gertrud Stauffacher die Schrift "Brot. Die monopolfreie Lösung der Getreidefrage durch die Frau." Danach folgten unter ihrem eigenen Namen mehrere Schriften zum biologischen Landbau und zur viehlosen Landwirtschaft. Hofstetter hielt im In- und Ausland zahllose Vorträge und veranstaltete auf "Stuhlen" Kurse über die Ernährung, das Sonnenbaden und die Freiwirtschaftslehre. Der 1936 auf dem Hof über dem Greifensee erbaute "Seeblick", eine "Lehrstätte für biologischen Landbau", wurde zum Treffpunkt der Ernährungsreformer. Hier wurde 1947 auch die Genossenschaft Biologischer Landbau (heute: Bioterra) gegründet, der sich in der Folge v.a. Klein- und Hobbygärtner anschlossen.
CHF 100.— (0.1 Lfm)
Foto: AGoF 626:1:22, Bioterra Nr. 155, Sept./Okt. 1994
-
Nelly Jaussi (1920-1984)
Promovierte Juristin. Mitarbeiterin Schweizerisches Frauensekretariat, erste Adjunktin im Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA). Leiterin Untergruppe Industrie an der SAFFA 1958. Einsatz für die Besserstellung der Frauen im Beruf.
CHF 100.— (0.1 Lfm)
Foto: AGoF BN 3036
-
Mathilde Lejeune-Jehle (1885-1967)
Ursprünglich Lehrerin. Im 1. Weltkrieg Hilfsschwester im österreichischen Kriegslazarett in Leipnik. Übernahme einer Arztpraxis in Kölliken zusammen mit ihrem Mann Erwin Lejeune. Engagement für eine bessere Schul- und Berufsausbildung für Frauen und Mitinitiantin für ein aargauisches Kindergärtnerinnenseminar. Einsatz für das Frauenstimmrecht sowie die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. 1940 Uraufführung ihres Theaterstücks „Gsetz und Gwüsse“, das die gängige schweizerische Flüchtlingspolitik kritisierte.
CHF 100.—(0.1 Lfm)
Foto: AGoF 579:1:1-01
-
Margrit Linck-Daepp (1897-1983)
Töpferin, Keramikkünstlerin, Erlernen des Töpferhandwerks in Heimberg. Leiterin eines Keramikateliers in Reichenbach bei Zollikofen.
CHF 100.— (0.3 Lfm)
Foto: AGoF 575
-
Berta Rahm (1910-1998)
Architektur-Studium an der ETH Zürich. In ihrem Beruf musste sie als Frau um Anerkennung und Aufträge kämpfen, was sie bis vor Bundesgericht führte. Für die SAFFA (Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit) 1958 in Zürich entwarf sie die ersten Projekte. 1963 nahm sie in Paris an der Gründung der Union International Femmes Architectes teil und besuchte später deren Kongresse in Monte Carlo und Bukarest. Sie setzte sich für das Frauenstimmrecht ein und beteiligte sich 1969 am „Marsch auf Bern". Zermürbt vom Kampf um Aufträge als Architektin sattelte Berta Rahm 1967 um, gründete den Ala-Verlag und begann das Leben von in Vergessenheit geratenen Frauen zu erforschen. Sie publizierte Biografien und legte Texte neu auf, die ihr für die feministische Debatte wichtig erschienen.
CHF 100.— (0.1 Lfm)
Foto: AGoF BN 5002